Laut Bundesärztekammer* praktizieren rund 2.300 Pathologen in Deutschland.
„Über sie und ihre Arbeit gibt es eine Menge Klischee- vorstellungen – und viele davon sind falsch oder zumindest nur halbwahr, wie etwa die vom ‚Leichenaufschneider‘“, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.** (DGP). Kriminalistisch gefärbt sei der Alltag der Pathologen selten, denn anders als Rechtsmediziner, die sich zumeist mit unnatürlichen Todesfällen auseinandersetzen, „beschäftigen sie sich vor allem mit lebenden Patienten und deren Gewebe unter dem Mikroskop.“ Das ist der wissenschaftlichen Fachgesellschaft zufolge in „etwa 95 Prozent“ der Fall.
Das bestätigt auch der Vorstand des Pathologischen Instituts der Universität Würzburg, Professor Dr. Andreas Rosenwald. „Wir machen pro Jahr etwa 50.000 Diagnosen von lebenden Patienten und haben im gleichen Zeitraum nur 50 Obduktionen.“ Er und seine Kollegen nehmen mit dem Mikroskop zum Beispiel Gewebe, das bei einer Magen-Biopsie entnommen wurde, in Augenschein oder sie begutachten einen herausgeschnittenen Leberfleck, um dann eine Diagnose zu stellen. Die wesentliche Domäne sei jedoch die Krebsdiagnostik, denn die Art des Krebses entscheide häufig über die weitere Therapie.
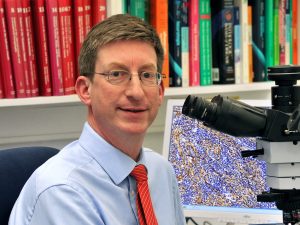
Pathologen arbeiten im Hintergrund. Ihr Vorteil: Sie agieren völlig unvoreingenommen und damit objektiv. Foto: Dr. A. Rosenwald ©E. Schmitt, Institut für Pathologie
Jeden Tag, so der gebürtige Hannoveraner, würden ihn etwa 40 bis 50 Fälle in Form von aufbereiteten Schnittpräparaten erwarten. Das sind 40 bis 50 Patienten, zu denen der Mediziner in der Regel keinen persönlichen Kontakt hat, obschon er nicht selten über Wohl und Wehe entscheidet. Die Vorgehensweise ist meist die gleiche. Das Gewebe wird in Formalin fixiert und in Wachsblöcke eingegossen. Danach wird es mit dem Ultramikrotom hauchdünn geschnitten und gefärbt.
In seinem Arbeitsalltag gebe es einfache Fälle, die sich nach dem „Schwarz-oder-Weiß-Prinzip“ schnell entscheiden ließen. Parat stehen Professor Rosenwald und sein Team in diesem Zusammenhang auch während Operationen – etwa zehn bis zwanzig Mal pro Tag. Dann helfen sie mit der sogenannten Schnellschnittdiagnostik. Gewebestücke werden direkt aus dem OP in ein Labor vor Ort gebracht, schockgefroren, geschnitten und gefärbt. So wird der Chirurg bei seinen weiteren Schritten unterstützt. Meist geht es um einen Krebsbefund. Der Operateur möchte wissen, ob dieser an einer bestimmten Stelle auch wirklich entfernt ist oder ob er weiter operieren muss.
„Solche Schnellschnitte haben in der Regel eingeschränkte Aussagekraft. Deshalb sind sie auch nur bei bestimmten, sehr groben Fragestellungen indiziert“, erklärt Rosenwald. Größere Präparate, etwa Teile des Darms oder des Bauchraums, bedürfen mehr Aufwand. Hier müssten viele verschiedene Aspekte betrachtet und für eine abschließende Diagnose zusammengebracht werden.
„Bei komplexen Befunden, gerade in der Krebsdiagnostik, gibt es eine ganze Reihe von Zusatzuntersuchungen“, weist der Experte etwa auf die Immunhistochemie hin. Dabei werden zum Beispiel Oberflächenproteine auf den Zellen dargestellt. Mit den gewonnenen Informationen kann dann die Tumorart festgelegt werden. „Häufig hat man einen Tumorherd, weiß aber nicht genau, wo er herkommt“, sagt Rosenwald. Deshalb würden hier Oberflächenmarker eingesetzt, die für bestimmte Organe recht spezifisch seien.
Weitere Methoden, die insbesondere in den vergangenen zehn Jahren zugenommen hätten, seien molekulare Untersuchungen. Hier gehe es häufig um Fragen nach der DNA und bestimmten Mutationen. „Das möchte man insbesondere in der Krebsdiagnostik wissen, um die Aggressivität eines Tumors zu beurteilen oder Therapieoptionen abzuleiten.“ Bei dieser prädiktiven genetischen Diagnostik werden Pathologen nach einem bestimmten Test gefragt, mit dem sie sagen können, ob bestimmte Medikamente wirken werden.
Aus gutem Grund, so Professor Rosenwald. „Es gibt zunehmend moderne Medikamente, für die es den Nachweis einer bestimmten genetischen Veränderung braucht. Erst dann dürfen Ärzte das teure Medikament verschreiben.“ Fast wöchentlich würden Pathologen gebeten, hierzu neue Tests zu etablieren. Dem fast immer geltenden Leitspruch „jede Krebsdiagnose stammt von einem Pathologen“ stimmt er absolut zu. Denn „niemand würde sich behandeln lassen, ohne sich wirklich sicher zu sein.“
Besprochen würden solche Ergebnisse mittlerweile in interdisziplinären Tumor-Boards. Entschied noch vor zehn Jahren der Chirurg, einen Tumor herauszuschneiden oder ein behandelnder Arzt eine Standard-Chemotherapie einzusetzen, würden sich heute die verschiedener beteiligten Fächer – auch die Pathologen – besprechen und in einem einstimmigen Votum die individuelle Vorgehensweise festlegen. Der Grund: Allein beim Brustkrebs kenne man inzwischen rund 30 verschiedene Arten, die nicht alle gleich behandelt werden können.
„Die Therapien werden in Zukunft immer spezifischer werden“, prognostiziert Professor Rosenwald eine massive Zunahme der Präzisionsmedizin. „Das Ziel ist, den Tumor mit spezifischen Medikamenten, von denen wir hoffen, dass sie deutlich weniger Nebenwirkungen haben als eine gegen alle Zellen gerichtete Chemotherapie, möglichst präzise dort zu treffen, wo er auch vulnerabel ist.“
Quellen: *Ärztestatistik 2016, www.bundesaerztekammer.de/leadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2016/Stat16AbbTab.pdf, ** https://www.pathologie-dgp.de/pathologie/was-ist-pathologie/





