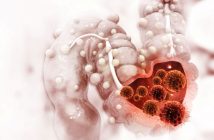Dr. Stephan Forster tritt als Unfallchirurg oftmals den Wettlauf mit der Zeit an und operiert in einem Grenzbereich, der ihn bisweilen selbst an seine Grenzen führt. Foto: Norbert Schmelz Fotodesign
Es ist diesmal mehr als nur ein „normales“ Interview zum Thema „Zeit“, das ich führe. Mein zweiter Gesprächspartner in unserer neuen Rubrik ist Dr. Stephan Forster, seines Zeichens Oberarzt der Unfallchirurgie in der Missionsärztlichen Klinik Würzburg (Missio) und im Notarzteinsatz tätig.
Mit großem Respekt für die Arbeit des Notfallmediziners gehe ich in das Gespräch, zu dem er sich nach rund 70 Stunden Wochenenddienst in der Notaufnahme bereiterklärt hat. Im Beruf von Dr. Stephan Forster geht es um mehr als nur die Zeit, obwohl sie die alles entscheidende Rolle spielen kann.
Es geht um Existenzielles, um Leben und Tod, einfach um alles! Mit wachem Blick, ruhig, und punktgenau beantwortet der 50-jährige meine Fragen. Alles Eigenschaften, die er täglich als Notfallmediziner sowohl im Klinikalltag als auch im Notarzteinsatz benötigt.
Meine Frage, ob er im Alltag permanent mit Blaulicht unterwegs sei, verneint er.
„Im Klinikalltag ist es eher der „kalkulierte Notfall“, sprich die OP auf die man sich mit etwas Zeit vorbreiten kann. Wenn man als Notarzt gerufen wird, klar, dann geht es um Minuten, manchmal nur um Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Da müsse man sofort präsent sein“, berichtet der Oberarzt, der seit 2009 zum Team der Chirurgischen Abteilung des Missio gehört.„Sofort präsent sein“ heißt beim Rettungseinsatz beispielsweise für Dr. Forster eine Reanimation bei Glatteis auf der Autobahnbrücke und anschließend eine Geburt im Rettungswagen.
In keinem anderen Beruf wird einem die Entscheidung über Leben und Tod so in die Hände gelegt und in keinem anderen Beruf liegt Leben und Sterben so nah beieinander. Ist man sich der Verantwortung immer bewusst?
„Ja“, sagt der Arzt aus Leidenschaft, der sich gegen den Willen seines Vaters für den Beruf entschieden hat, weil er den Menschen helfen will. Im OP nehme er sich vor dem ersten Schnitt immer ein paar Sekunden Zeit und auch im Rettungseinsatz müsse man ruhig und gelassen das, was man in der Ausbildung erlernt und durch jahrelange Erfahrung erworben habe, möglichst präzise umsetzen.
„Hektik ist hier der Feind einer guten Entscheidung!“ Wenn es um Leben und Tod geht, muss der Notfallmediziner vor Ort oftmals in Sekunden eine Entscheidung treffen, die ein Anderer auch mit viel Zeit womöglich nie treffen könnte.
Da hat Emotionalität oder Aufgeregtheit keinen Platz. Da ist Ratio gefragt. Doch auch der versierteste Arzt ist nur ein Mensch. Und gerade in der Notfallmedizin gelingt es oft nicht, einfach den Kittel auszuziehen und in den Feierabend zu gehen.
„Es gibt Patienten, die schon Jahre her sind, über die ich immer noch nachdenke“, räumt der engagierte Mediziner ein.
„Und es gibt immer diesen einen Patienten, der einem keine Ruhe lässt. Bei dem man nach einer Lösung sucht, um das Bestmögliche für eine baldige Genesung zu tun“.
Das ist gefährlich, gerade in diesem Beruf, wo das Ausbrennen vorprogrammiert ist, wenn man zu sehr seine Berufung lebt. „Neben der aktiven Phase, die einem sehr viel abverlangt, in der man oft alles gibt, muss es auch die passiven Zeiten geben, wo man wieder auflädt“, betont Dr. Forster, dem es oft selbst nicht gelingt, sich diese Auszeiten zu nehmen.
Auszeiten, die jedoch für die psychische Hygiene des Arztes unerlässlich sind, um mit den Ausnahmesituationen seines Berufs zurechtzukommen. Zeiten der Reflektion, der Supervision, des Verarbeitens und Wiederauftankens. Die Zeit des Dr. Stephan Forster für sich ist rar.
Schlimme Schicksale, Katastropheneinsatze oder Todesfälle werden durch Gespräche im Team be- und verarbeitet. „Manchmal sucht man nicht das Gespräch. Es gibt Begebenheiten, mit denen man in der Stille, allein, klarkommen will“, so der emphatische Arzt, der – wie er selbst sagt – seinen Traumberuf lebt.
Der Tod von Patienten gehört sicher zu einer dieser „Begebenheiten“, die man mit sich selber ausmachen muss.
Tagtäglich erlebt er den Tod, muss damit umgehen. Hat er damit umgehen gelernt? „Der Tod gehört zu unserer Arbeit. Dadurch nehmen wir ihn anders wahr“, so Dr. Forster. Routine werde der Tod für ihn jedoch nie! Jedes Sterben sei anders und egal wie professionell man ist, es geht einem unter die Haut.
Der Beruf hinterlässt Blessuren in der Seele, die auch mit der Zeit nicht vergehen. Von wegen, die Zeit heilt alle Wunden… Unverständlich ist dem Arzt mit viel sozialer und emotionaler Kompetenz, wie Angehörige davor zurückscheuen, beim Sterben ihrer Mütter oder Väter dabei zu sein. Auf die Frage, ob sie nachts angerufen werden wollen, komme oft die Antwort: Es reiche auch morgens…!
Heute wird nicht mehr wie früher zuhause gestorben, sondern leider viel zu oft in der sterilen Umgebung einer Intensivstation. Die Möglichkeit, selbst den Tod naher Angehöriger an das Personal eines Krankenhauses zu delegieren, zementiert das Tabuthema „Tod“ noch fester ein in unsere blutleere High-Speed-Dienstleistungs-Gesellschaft. Klar, für den Tod müsste man sich ja auch Zeit nehmen, Zeit dabei zu sein, Zeit zum Verarbeiten und Zeit zum Drüberhinwegkommen.
Zeitlich indiskutabel in einer Welt, die „Zeit“ in Geld und Lebensqualität in Statussymbolen misst.
Zeitpolitik hat sich gegenüber früher stark verändert. Die „anderen Zeiten“ haben in Bereiche Einzug gehalten, wo sie – meiner Meinung nach – nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel in die der medizinischen Versorgung und Pflege.
Selbst hier gibt es Zeitvorgaben und Fallpauschalen. „Natürlich gibt es auch bei uns Zeitvorgaben, gerade bei Routine-OPs“, so der Chirurg, der seit vielen Jahren täglich im Operationssaal steht. Aber im OP sei er zeitunempfindlich. Er nehme sich die Zeit, die erforderlich sei, für den Eingriff.
Da habe er seine Profession vor Augen, nicht die Zeit. Ganz dürfe man die Zeit jedoch nicht vergessen, da es auch zum Wohle des Patienten sei, dass dieser so kurz wie möglich unter Narkose gehalten werde. Auch beim Anlegen einer Blutsperre (Druckmanschette an den Extremitäten), dürfe man die Zeit nicht aus den Augen verlieren.
Hier müsse mit Augenmerk auf die Patientensicherheit in einem bestimmten Zeitfenster operiert werden. Genauso im Klinikalltag, der für Dr. Stephan Forster zwischen OPs, Visite auf der Station, Besprechungen und Sprechstunde in der Ambulanz von morgens um 7 Uhr bis nachmittags um 17 Uhr durchgetaktet ist, nimmt er sich Zeit für den Menschen.
Denn trotz aller technischer Möglichkeiten der modernen Medizin liegt der Schlüssel für Heilung für ihn im Arzt-Patienten-Verhältnis begründet.
„Ich muss fühlen, was der Patient fühlt, um ihm helfen zu können. Daher muss ich mir Zeit für Gespräche mit ihm und Zeit für die anschließende Diagnose nehmen!“, so Dr. Forster.
Er sehe den Körper nach wie vor als größte Meisterleistung, dem man nur Zeit geben und als Arzt behilflich sein müsse, sich zu regenerieren. Am Ende des Gesprächs kann ich nur zu sagen „Chapeau, Dr. Forster für so viel Zeitunempfindlichkeit.
Schön, dass es das noch gibt!“
Und nun entlasse ich den Unfallchirurgen aus meiner „Sprechstunde“, da morgen um 7 Uhr für ihn wieder der zeitintensive Klinikalltag im Missio beginnt.
Das Interview mit Dr. Stephan Forster, Notarzt und Oberarzt der Unfallchirurgie in der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg, führte Lebenslinie-Chefredakteurin Susanna Khoury.
Aus rechtlichen Gründen und aus Rücksicht auf den lebensrettenden Betrieb einer Notaufnahme wurden die Bilder von der Redaktion nachgestellt. Danke an unseren Fotografen Norbert Schmelz und unseren Gesprächspartner Dr. Forster, der jenseits aller Ernsthaftigkeit seiner Profession auch für den Spaß eines Fotoshootings zu haben war.