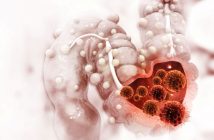„Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?“ Bei der Äußerung dieser Fragen hat John Fitzgerald Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, den Pflegenotstand des 21. Jahrhunderts in Deutschland sicher nicht mitgedacht, dennoch passt jedes einzelne Postulat vornehmlich gut, um genau jetzt auf den „Pflegefall Pflegebranche“, wie der Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse¹ es tituliert, hinzuweisen. Wie die überlebensnotwendige Mund-Zu-Mund-Beatmung der „Pflege“ in Deutschland aussehen könne, darüber hat sich die Lebenslinie-Redaktion mit Oberpflegamtsdirektor und Leiter der Stiftung Juliusspital Walter Herberth unterhalten.
Die Corona-Krise wurde zum Brennglas für Personalmangel (2019 rund 40.000 nicht besetzte Stellen in Deutschland¹) und grenzwertige Arbeitsbedingungen in der Pflege. Der Applaus für systemrelevante Berufe ist verhallt, was muss nun auf der Agenda stehen, dass Pflegekräften in Deutschland der Rücken gestärkt wird, sodass Schwestern und Pfleger auch in Zukunft, einen Sinn darin sehen, an vorderster Front für alte, kranke und hilfsbedürftige Menschen da zu sein, und ein Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, das zu den besten der Welt gehört?
Was sich ändern muss
„Zum einen muss generell das Image des Pflegeberufs verbessert werden, damit sich wieder mehr junge Menschen für diesen erfüllenden Beruf entscheiden“, betont Walter Herberth, der mit der Stiftung Juliusspital, die heuer ihr 444-Jähriges feiert, mutig voranschreitet. Im geplanten Neubau der Stiftung auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik soll ein großes Pflegebildungszentrum entstehen – mit Schulungsräumen für neue Anwärter der generalistischen Pflegeausbildung. Die oft ins Feld geführte schlechte Bezahlung des Berufs findet der Juliusspitalchef gar nicht so schlecht. Mit 2.900 Euro bis 3.500 Euro brutto (ohne und mit zusätzlichen Diensten wie Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsdienste) im ersten Jahr und 3.600 bis 4.300 Euro (ohne und mit Zusatzdiensten) in der Endstufe bei der Altenpflege habe sich in punkto Vergütung einiges getan – wohlgemerkt, wenn nach Tarif bezahlt werde. Auch die Vergütung für die Azubis von 1.100 Euro brutto im ersten Jahr, 1.200 Euro im zweiten Jahr und 1.300 Euro im dritten Jahr hält Herberth im Vergleich zu anderen Berufen für mehr als annehmbar.
Nichtsdestotrotz könne beispielsweise mit der Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich die Attraktivität des Pflegeberufs noch gesteigert werden, oder mit der Verlässlichkeit von Dienstplänen, dessen Fehlen er als Hauptkritikpunkt immer wieder höre. Die Stiftung Juliusspital schaffe

Was sich für Pflegekräfte ändern muss, dazu hat der Juliusspitalchef Walter Herberth einige konstruktive Ideen.
daher jetzt fünf neue Vollzeitstellen im Pflegheim der Stiftung. Pro Jahr würden dadurch rund 300.000 Euro mehr auf der Personalkostenstellle auflaufen. „Das kann sich eine Stiftung vielleicht leisten, ein Krankenhaus eher nicht, vor allem nicht in diesem Jahr, in dem wegen Corona viele elektive Operationen ausgesetzt worden sind“, so Herberth, der auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Klinik Würzburg Mitte (KWM) ist, zu dem seit 2017 auch das Krankenhaus Juliusspital gehört.
„Das 675-Betten-Haus wurde auf Geheiß der Bundesregierung zur Hälfte leer gemacht. Insgesamt wurden bis dato rund 350 Corona-Patienten im KWM behandelt“, berichtet Herberth. Die Ausgleichspauschale vom Staat von 560 Euro pro Tag und Bett decke aber, wie es ausschaut, nicht den Ausfall der Einnahmen, die durch das Verschieben geplanter OPs entstanden sind. Leider werden deutsche Krankenhäuser seit der Einführung des Fallpauschalen-Systems 2003/2004 wie Wirtschaftsunternehmen behandelt, die Gewinne erzielen müssen, um am „Markt“ bestehen zu können.
Da fange das ganze Dilemma schon an, so Walter Herberth. „Die Feuerwehr wird ja auch nicht nur dann bezahlt, wenn es brennt…“, mahnt der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt die Tatsache an, dass Krankenhäuser Kapazitäten, Manpower und Material für den Katastrophenfall vorhalten und parallel noch das Postulat der Wirtschaftlichkeit erfüllen sollen. Das habe beispielsweise dazu geführt, dass zu Beginn der Pandemie eben nicht genügend Masken für alle Bediensteten einer Einrichtung vorhanden waren, und aufgrund der weltweiten Nachfrage dann auch nicht schnell beschafft werden konnten.
Lektion gelernt?
Deutschland ist in der Pandemie mit rund 200.000 Corona-Infizierten und rund 9.000 Toten bisher relativ „glimpflich“ davongekommen im Vergleich zu europäischen Nachbarn wie Frankereich mit rund 275.000 Infizierten und 30.000 Toten oder Italien mit rund 258.000 Infizierten und 35.000 Toten. Gar nicht zu reden vom Blick nach Übersee mit rund 5,6 Millionen Infizierten und 176.000 Toten in den USA (Stand 23. August 2020). Eine Rückkehr zum Regelbetrieb in den Altenpflegeeinrichtungen und Kliniken ist längst
geschehen, eine Rückkehr zum Business as usual in die „Vor-Corona-Zeit“ für die Sektion „Pflege“ darf es jedoch nicht geben. Zumindest nicht, wenn Deutschland auch in Zukunft in Sachen Gesundheitsversorgung vorne in der Weltspitze mitspielen will.
Nachweislich haben Arbeitsbedingungen, die sich auch in einer überproportional hohen Burn-out-Quote in Gesundheitsberufen widerspiegelt, zu Personalmangel und Jobflucht in der „Pflege“ geführt, die das Robert Koch-Institut bereits 2012 prognostizierte²: „Wenn Helfer Hilfe brauchen. So könnte die Überschrift lauten, die die Verfassung vieler Menschen kennzeichnet, die im Rahmen ihrer Helferrolle in einem sozialen Beruf Risiken für die eigene Gesundheit erfahren und ihr seelisches Gleichgewicht bedroht sehen.“
Für Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt sowie als Reformerin des englischen Gesundheitswesens, wäre eines der schönsten Geschenke zu ihrem 200. Geburtstag in diesem Jahr, wenn die bisherigen Lehren aus der Pandemie auf fruchtbaren Boden fielen. Hier müsse vor allem ein Ruck durch die politischen Reihen gehen, ist sich der Leiter der Stiftung Juliusspital sicher. Er kämpft dafür Seite an Seite mit anderen Partnern aus dem Gesundheitswesen, etwa bei einem trägerübergreifenden Krankenhaus-Verbund von 65 Kliniken wie Clinotel oder in der Region mit einem neuen Format, dem „Klinikschoppen“, das reformbedürftige Themen öffentlich macht und gemeinsam mit Akteuren und Verantwortlichen aus dem Bereich „Gesundheit“ nach Lösungen sucht.
Darüber hinaus will das Juliusspital zusammen mit dem Bürgerspital im Bundesverband der Stiftungen vor allem die Interessen der Altenpflege in Richtung Politik tragen. Auf jeden Fall nicht, ohne zwischen den Zeilen den weltweit bekanntesten Wissenschaftler der Neuzeit, Albert Einstein zu zitieren: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert!“
Quellen:
¹www.tk.de/resource/blob/2066542/2690efe8e801ae831e65fd251cc77223/gesundheitsreport-2019-data.pdf, ²www.rki.de/DE/Content/Service/Sozialberatung/BGBL_Stressmanagement.pdf?__blob=publicationFile
Das Interview mit Oberpflegamtsdirektor und Leiter der Stiftung Juliusspital Walter Herberth führte Lebenslinie-Chefredakteurin Susanna Khoury.