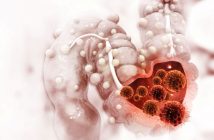In der Aprilausgabe 2021 der Lebenslinie haben wir mit Oberpflegamtsdirektor und Leiter der Stiftung Juliusspital Walter Herberth darüber gesprochen, welche Rahmenbedingungen sich in der „Pflege“ ändern müssen, damit langfristig kein Versorgungsmangel in Deutschland droht. Der Markt an Pflegekräften sei „leergefegt“, mahnte er damals. Was sich verändert habe, sei der Grad der Aufmerksamkeit. Doch ist dem so? Im dritten Teil dieser Serie fragt die Lebenslinie nach. Denn bereits seit dem 15. September 2020 gehen aus guten Gründen mittlerweile 25 Organisationen, denen über 30.000 Mitarbeitende angehören, bei den „Dienst-Tag-für-Menschen“-Demonstrationen in Würzburg (und nicht nur dort) auf die Straße. Bislang scheint es, dass das Brennglas „Corona“ nicht wirklich etwas ausrichten konnte. Herberth, der zu den Initiatoren des „Dienst-Tags für Menschen“ gehört, wundert das nicht. Mit schnellen Erfolgen habe keiner gerechnet. Gleichzeit habe sich seit Herbst 2020 einiges getan: „Der Bundestag hat die Pflegereform in einem ersten Schritt auf den Weg gebracht und insbesondere festgelegt, dass ab September 2022 nur noch solche Pflegeeinrichtungen ihre Kosten mit den Pflegeversicherungen abrechnen können, die die Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarifvertrag entlohnen.“

Walter Herbert ©Stiftung Juliusspital
Aber, so Herberth weiter, es müssten noch weitere, deutliche Schritte folgen, um in der Zukunft eine humanitäre Katastrophe in Deutschland zu verhindern. Erfreulicherweise habe eine Partei die Forderung nach einer 35 Stundenwoche in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Die Probleme des Pflegekräftemangels, der vom Statistischen Bundesamt bis zum Jahr 2035 auf rund 300.000 fehlende Pflegekräfte beziffert wird, sind jedoch vielschichtiger. „Die Attraktivität der Berufe am Menschen ist leider sukzessive gesunken“, so Herberths Diagnose. Durch eine immer stärkere Ökonomisierung und rigidere Vorgaben des Gesetzgebers sowie der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Krankenhäusern und Pflegeheimen habe das Pflegepersonalbudget zunehmend auf Kante genäht werden müssen. Die Folge sei häufig die Wahrnehmung einer Überlastung bis hin zur fehlenden Zuverlässigkeit der Planbarkeit freier Tage.
„Wir sind Stück für Stück in eine Spiralbewegung gezwungen worden, die nach unten führt.“ Diesen Trend gelte es zu stoppen und umzukehren. Es steht zu befürchten, dass im Jahr 2060 rund 4,5 Millionen pflegebedürftige Menschen betreut werden müssen. In den nächsten Jahren gehen zudem viele Pflegekräfte in den Ruhestand und es kommen nicht genügend nach. Die Lücke von rund 300.000, schätzt das Bundesamt, werde dadurch auf rund 500.000 anwachsen. Herberth und seine Mitstreiter:innen führen deshalb seit September 2020 mit Politiker:innen aller Parteien ausführliche Gespräche, inklusive eines Expert:innen-Hearings kurz vor der Bundestagswahl. Außerdem, so betont er, müsse „in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung das Image der helfenden Berufe“ wieder verbessert werden.
„Dazu müssen wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und die Ökonomie auf ihre unterstützende Funktion reduzieren.“ Überbordende bürokratische Dokumentationspflichten und zu lange Arbeitszeiten seien derzeit Aspekte, die das verhindern würden. Anders sehe das beim Thema Ausbildung aus. Diese sei durch die Generalistik nun deutlich attraktiver. Und wie steht es im Juliusspital? „Um die Situation zu verbessern hat das Oberpflegamt im vergangenen Jahr beschlossen, über den von den Kassen finanzierten Stellenplan hinaus fünf zusätzliche Stellen auf Kosten der Stiftung zu besetzen.“ Damit soll ein Springerteam besetzt werden. Bislang sei das nur zeitweise gelungen. „Aber wir arbeiten daran.“
Das Interview mit dem Leiter der Stiftung Juliusspital Walter Herberth führte Lebenslinie-Chefredakteurin Susanna Khoury.